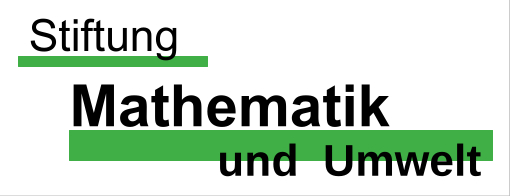
Themen
Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes arbeiten beispielsweise an folgenden stiftungsrelevanten Themen:
Wetterphänomene / El Niño
El Niño nennt man das Auftreten ungewöhnlicher, nicht zyklischer, veränderter Meeresströmungen im ozeanographisch-meteorologischen System des äquatorialen Pazifiks. Das Phänomen tritt in unregelmäßigen Abständen von durchschnittlich vier Jahren auf (Wikipedia). Europa wird von einem El Niño-ähnlichen Phänomen beeinflusst, welches sich im Atlantik abspielt und entscheidenden Einfluss auf das europäische Wettergeschehen hat (El-Niño-Infoseite).
Auftauen des Permafrosts
Der im Boden gespeicherte Kohlenstoff tritt an immer mehr Stellen aus. Das kann schwerwiegende Folgen für das globale Klima, die biologische Vielfalt und die Menschen haben. Die weitere Verbrennung fossiler Energieträger durch den Menschen trägt dazu bei, dass der Permafrost zunehmend gefährdet ist.
Methan ist ein wichtiges Greenhousegas, das die atmosphärische Chemie bestimmt; sein direktes, globales Potential zu Erwärmung ist das 39-fache dessen von Kohlendioxid.
Die Hauptquelle der Methanzufuhr in die Atmosphäre kommt aus der Landoberfläche. Um zukünftige Methanströme in die Atmosphäre abzuschätzen, benötigt es mathematische Modelle. Dabei sind die Prozesse, die in der Permafrost-Zone ablaufen, von besonderer Wichtigkeit.
Während der Einfluss von Wetland-Oberflächen seit Jahren studiert wird, wurden die Emissionen von Seen wenig beachtet, obgleich jüngste Beobachtungen deren große Bedeutung für das Klima festgestellt haben.
Die mathematische Untersuchung des Auftauen des Permafrosts und die daraus resultierende Berücksichtigung in Klimamodelle sind aktuell weltweites Forschungsgebiet.
Erdrutsche und Geröllabgang
Die häufigste Ursache eines Erdrutsches ist, dass der Erdboden am Hang zu große Mengen an Wasser, beispielsweise infolge von Starkregen, durch Schneeschmelze oder Auftauen des Permafrosts, aufgenommen hat. Wegen zu geringer innerer Haftung folgt daraus ein Verlust der Stabilität entlang einer sich ausbildenden Gleitfuge (Wikipedia). Wichtig ist herauszufinden, wann eine Geröllmenge einen Erdrutsch auslöst, und wie dieser sich fortbewegt. Mathematische Modelle und Berechnungen hierzu sind Gegenstand aktueller Forschung.
Materialmodelle: Stabilität von Bauwerken und Hängen
Die Vorhersage von Erdrutschen oder Schädigungen an Bauwerken benötigt zuverlässige mathematische Methoden für moderne Materialmodelle aus den Ingenieurwissenschaften. Von besonderem Interesse ist hier die Modellierung von Scherbändern vor Entstehung eines Bruches, ob im Erdboden eines Hanges oder im Beton eines Bauwerkes. Aktuelle Forschung untersucht sowohl effiziente numerische Methoden für Scherbandbildung und große Deformationen, als auch analytische Vorhersagen für komplexe Materialien in einfachen Modellsituationen.
Gletscherschmelze
Die Formulierung glaziologischer Probleme mit Kontakt führt auf Variationsungleichungen vom Stokes Typ. Zwei wichtige solcher Probleme sind
(a) die Grundlinie einer Eisschicht, die vom Kontinent ins Meer fließt, wobei das Eis den Kontakt mit dem Untergrund verliert, und
(b) die Bildung von Hohlräumen unter dem Gletscher.
Ein genaues Verstehen sowohl der Grundlinie als auch der Hohlraumbildung unter dem Gletscher ist von großer Bedeutung, um den künftigen Anstieg des Meeresspiegels vorherzusagen.
Numerische Simulationen mit Finiten Elementen für solche zeitabhängigen Probleme sind im Fokus heutiger Forschung.
Materialermüdung
Ermüdung ist ein wichtiger Faktor für die verkürzte Lebenszeit von Werkstoffen mit zahlreichen negativen Folgen. Erhöhtes Sicherheitsrisiko und zusätzliche Umweltbelastung sind nur zwei davon. Einige Ursachen für die Ermüdung sind zyklische Belastung, Sonneneinstrahlung und chemische Einwirkung. Solche Einwirkungen sind oft nur näherungsweise bekannt, oder treten zufällig ein. Mathematisch kann Ermüdung als Degradation von Materialparametern im entsprechenden physikalischen Modellen erfasst werden. Effiziente numerische Quantifizierung von Unsicherheiten in solchen Vorgängen ist oft schwierig und ist der Gegenstand der aktuellen Forschung.
Vegetation bei Flut und Ebbe: Zeitreihenanalyse für Daten mit Lücken
Ökosysteme der Uferzone sind sehr besonders. Um zu verstehen, wie Pflanzen an der Uferzone ansiedeln und sich entwickeln, ist es wichtig die durch die Überschwemmung bedingte Variation der Parameter, wie Wasserstand, Temperatur, Salzgehalt, usw. zu erfassen und analysieren. Dabei sind Kurzzeitzyklen (Tag-Nacht) und die Langzeitzyklen (Jahreszyklen) von Bedeutung. Standardmethoden, wie die schnelle Fourier-Transformation, verwenden gleichmäßig verteilte Datenpunkte. In der Realität sind erfasste Daten häufig lückenhaft, weil die Sensoren zur Erfassung von Daten nicht immer zuverlässig funktionieren. Die Zeitreihenanalyse für Daten mit Lücken bedarf verbesserter numerischer Methoden. Die Verbesserung der Effizienz solcher Methoden und ihre Anwendung für realistische Datensätze ist im Fokus der aktuellen Forschung.
Strömungen in porösen Medien
In diesem Themenbereich werden Strömungen in porösen Medien mit Hilfe der Biot-Gleichungen mathematisch modelliert. Darin koppeln elastische Verschiebungen mit Gleichungen der Strömungsmechanik, welche dem Darcy-Gesetz unterliegen. Das resultierende Modell ist ein lineares quasi-statisches gekoppeltes System partieller Differentialgleichungen. Diese werden mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode diskretisiert und anschließend gelöst. Die Verifizierung kann anhand des sogenannten Mandel-Benchmarks durchgeführt werden (Abb. 1; Druckprofil an zwei verschiedenen Zeitpunkten).
Petrothermale Geothermie
In der petrothermalen Geothermie wird durch eingepresstes kaltes Wasser in die Erdkruste die gespeicherte Wärme genutzt, um so das erhitzte Wasser beispielsweise zum Heizen oder Erzeugung von elektrischem Strom zu nutzen. Das Einpressen des Wassers erzeugt (neue) Risse neben bereits vorhandenen Klüften. Mathematisch werden hier die Biot-Gleichungen mit einer Wärmeleitungsgleichung und einer Phasenfeldmethode gekoppelt. Letztere dient zur approximativen mathematischen Beschreibung der Risse. Das resultierende Modell ist ein instationäres, gekoppeltes, nichtlineares System von Variationsungleichungen, welche zur Zeit intensivst mathematisch, numerisch und ingenieurswissenschaftlich untersucht werden. Eine aktuelle numerische Simulation ist in Abb. 2 (Konfiguration und Temperaturverteilung nach der Rissentwicklung) zu sehen.
Küstenschutz / Belastung auf Deiche
Für die Ausbildung des Deichquerschnittes und der Deichaußenböschung haben die Belastungsarten einen wesentlichen Einfluss. Maßgeblich sind hierbei vor allem die Höhe der auf dem Deich brechenden Wellen und deren Ablauf. (Konstruktive Maßnahmen zur Stabilisierung von Deichen, Nino Ohle, Sven Dunker) Zur mathematischen Beschreibung der Sickerströmung durch den Deich (poröses Medium) werden Darcy-Brinkmann-Forchheimer Gleichungen genommen. Deren Behandlung mit Finite Elemente Methoden ist weltweit Gegenstand der mathematischen Forschung.
Schallabstrahlung
Der zunehmende Straßenverkehr ist leider auch mit einer Zunahme der Geräuschbelästigung verbunden. Dabei sind die Eigenformen eines Bauteils entscheidend für das im Betrieb erzeugte Geräusch. Mit Hilfe von Randelementmethoden können
die Eigenformen und die Schallabstrahlung von Reifen und Getrieben numerisch ermittelt werden.
Diese Ergebnisse können verwendet werden, um zum Beispiel durch Geometrieänderungen das Spektrum des Geräusches zu verändern und die Amplituden des abgestrahlten Schalls zu verringern.